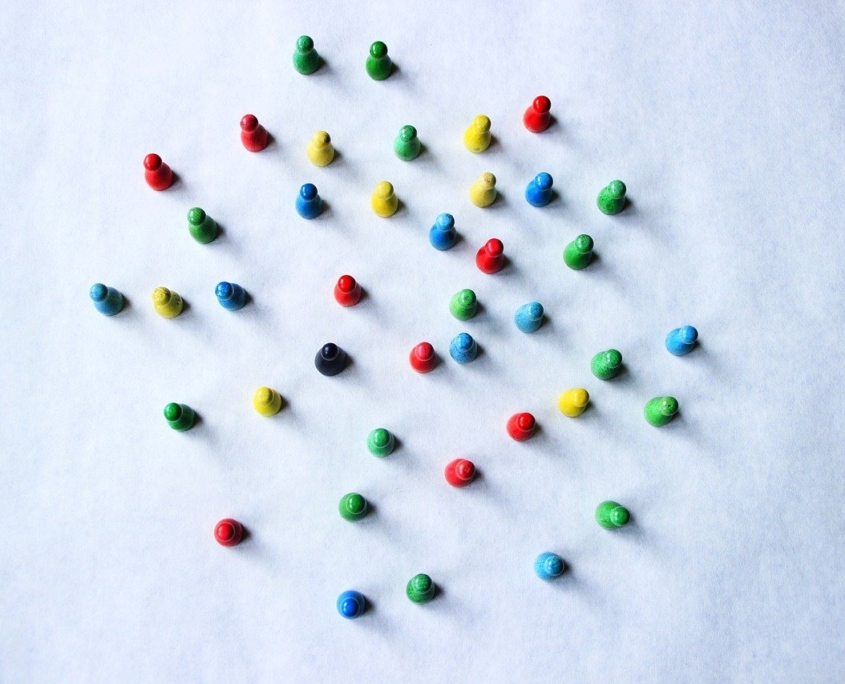Claus Dierksmeier | Oktober 2020
Corona und die „offene Gesellschaft“
In der Corona-Krise beschränkten Staaten die Freiheiten ihrer Bürger auf augenfällig unterschiedliche Weise, etwa durch gesundheitspolitische Vorschriften, Triage-Entscheidungen oder beim Einsatz digitaler Technologie. In einigen Ländern kam es zu einer autoritären Politik, während in anderen auch andernorts weitgehend klaglos akzeptierte Ordnungsvorgaben populistische Gegenreaktionen hervorriefen. Durch beide Extreme sind „offene Gesellschaften“[1] herausgefordert. Im ersten – autoritären – Fall wird ihre Freiheitlichkeit direkt angegriffen, im zweiten – libertären – Szenario verläuft der Angriff indirekt: über das Untergraben der zu jeder nachhaltigen Freiheitswahrung unverzichtbaren Verantwortung. Beides bedarf einer Kritik im Ausgang von der Idee der Freiheit, auf die sich offene Gesellschaften stützen. Wer aus der Corona-Pandemie lernen möchte, wie sich künftige Ausnahmezustände bewältigen lassen, ohne die demokratischen Institutionen und pluralistischen Kulturen freiheitlicher Gesellschaften zu beschädigen, sollte, so meine These, die Corona-Krise auch als Herausforderung der „offenen Gesellschaft“ und ihrer Legitimitätsgrundlagen analysieren.
Was auf dem Spiel steht…
Ausnahme- und Notsituationen stellen alle Gesellschaften vor große Herausforderungen. Während jedoch Staatswesen, die nach dem „command-and-control“-Prinzip geordnet sind, sich in Krisenmomenten umstandslos auf diktatorische Entscheidungs- und Ordnungsverfahren stützen, ist die Umstellung auf „klare Ansagen von oben“ für offene Gesellschaften schwieriger.[2] Was in nicht-demokratischen Gesellschaften bloß als Ausweitung ohnehin prädominanter Herrschaftspraktiken erscheint, stellt in pluralistisch verfassten Demokratien einen Sprung in unvertraute Governance-Formen dar. Während „drüben“ seit jeher das Diktum der Macht mit dem (angeblich) besseren Wissen und Können der Machthaber legitimiert wird, verfangen „hüben“ – bei Bürgern offener Gesellschaften, die sich weder als Untertanen noch als Unmündige verstehen – derartige Legitimationsstrategien nur selten. Dies zeigen auch die unterschiedlichen Reaktionen auf das staatliche Krisenmanagement in demokratischen Gesellschaften, welche, grob vereinfacht, in drei Gruppen aufgeteilt werden können.
Erstens sind da Länder wie Polen und Ungarn, in denen Regierungen die Krise nutzten, um bereits laufende Bewegungen hin zu immer autoritäreren Governance-Stilen zu beschleunigen. Das Argument zur Rechtfertigung jener Entwicklungen war, man müsse sich im Interesse des Gemeinwohls ohnehin von einer Überbetonung der persönlichen Freiheit lösen. Die Krise stelle dies nur weiter unter Beweis und verstärke den Handlungsdruck.
Zweitens zeigt ein Blick auf die USA dazu das Gegenbild: eine Gesellschaft, die im Namen einer (allzu oft eng libertär verstandenen) Freiheit zusehends Widerstand leistet gegen behördlich verordnete Maßnahmen. Dieser richtet sich sowohl gegen Begrenzungen individueller Freizügigkeit als auch gegen die Einforderung von mehr persönlicher Verantwortung der Bürger füreinander.
Beide Phänomene bestärken einander. Wo Freiheit als verantwortungslose Freizügigkeit auftrumpfen kann, folgt der Ruf nach ihrer autoritären Beschränkung auf dem Fuße. Umgekehrt, wo autoritäre Systeme auf dem Vormarsch sind, verstärkt sich die zivile Reaktanz gegen jedwede Begrenzungen bürgerlicher Freiheiten. Beides bedroht die – nicht nur zur Krisenbewältigung– unerlässliche soziale Balance aus individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung.
Das zeigt sich drittens auch hierzulande. Beide Tendenzen finden sich, wenngleich mit von Land zu Land wechselndem Gewichtsanteil, in der öffentlichen Meinung auch von Staaten wieder, die jenseits von Diktat und Chaos einen gangbaren Weg aus der Krise fanden. Auch in der Bundesrepublik etwa räsonierten einige, die Krise belege das überfällige Ende der (neo-)liberalen Ära, während andere umgekehrt die Idee der Freiheit lautstark im Mund führten, um gegen die aus „physical distancing“ resultierende Reduzierung ihrer alltäglichen Handlungsoptionen zu opponieren. Obschon also vielen Ländern Mitteleuropas eine Balance zwischen persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung – in der Praxis – gelang, so wurde dieselbe – theoretisch – von Dissidenten bestritten, und zwar indem man entweder (in der autoritären Variante) in Abrede stellte, dass eine solche Balance überhaupt möglich bzw. (in der libertären Fassung), dass sie notwendig sei.
Solche Dispute zeigen auf, wie brüchig der Hintergrundkonsens offener Gesellschaften ist. Dass jene Kräfte, die mit politischen Extremen flirten, hierzulande noch schwächer ausgeprägt sind als anderswo, ist dabei nur ein schwacher Trost. Denn eine „offene Gesellschaft“ lässt sich allein dort auf Dauer bewahren, wo ihre bisweilen unliebsamen Entscheidungen weitgehend freiwillig akzeptiert werden, also nicht unter Verdacht fallen, das freiheitliche Prinzip der sozialen Ordnung zu untergraben oder aber lediglich als faule Kompromisse erscheinen.
Seitens des „Establishments“ die autoritären und libertären Extreme zu tabuisieren, reicht also nicht hin. Der Weg einer sich dynamisch-situativ anpassenden Balance zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung bedarf vielmehr einer eigenständigen argumentativen Aufwertung. Denn nur sofern freiheitliche Politik auch populär zu sein versteht, muss sie sich nicht vor Populismus fürchten. Sie kann aber nur populär sein, wenn sie Beschränkungen individueller Freizügigkeit nicht schlicht als „notwendiges Übel“ oder alternativlosen „Sachzwang“ ausgibt, sondern als in der Idee der Freiheit selbst liegende Bindungen auszuweisen vermag.
Wozu es philosophischer Reflexion bedarf…
Ohne theoretische Synthese zwischen Freiheit und Verantwortung droht deren praktische Verbindung in Schwierigkeiten zu geraten. Und umgekehrt: Wenn eine Freiheitstheorie klare Kriterien für den legitimen Freiheitsgebrauch definieren kann, vermag dies sowohl ihre Umsetzung im Alltag zu erleichtern als auch ihre öffentliche Akzeptanz zu bestärken. Der allfällige und in den Medien immer wieder aufs Neue bekräftigte Eindruck, dass es klarerweise bessere und schlechtere Wege gibt, Pandemien zu managen, findet sich dabei dadurch bestätigt, dass in der Tat schon seit jeher Freiheitstheorien verschiedenster Art und Herkunft zu unterschiedlichen Strategien beim Bewältigen von Notständen raten – jeweils mit dem Argument, dass einige der krisenbedingten Einschränkungen die Freiheiten offener Gesellschaften untergraben, während andere sie schützen und stützen.
So hat die Corona-Krise ja vor unser aller Augen ganz unterschiedliche Freiheiten miteinander in Konkurrenz gebracht (z.B. die wirtschaftliche Freiheit mittelständischer Unternehmer oder die Bewegungs- und Vereinigungsfreiheit weiter Bevölkerungsgruppen gegenüber den Freiheitsrechten auf Gesundheit und auf Überleben besonders gefährdeter Bürger, von Ärzten und Pflegepersonal). Dies zeigt: Das allgemeine Bekenntnis zur Freiheit als Prinzip offener Gesellschaften reicht keineswegs hin, um dort konkrete Entscheidungen zu treffen, wo die Freiheiten der einen mit den Freiheiten der anderen in Konflikt treten. Um in solchen Fällen Orientierung zu bieten, wäre zunächst zu klären, welche Freiheiten und wessen Freiheiten je nach dem herangezogenen Modell jeweils gestärkt oder geschwächt werden – und nach welchen normativen Gesichtspunkten dies von Fall zu Fall zu bewerten wäre. Denn bei Epidemien und Notfällen trifft bekanntlich die Last der Krise selten alle, etwa Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete, gleichermaßen.[3] Das war und ist in der gegenwärtigen Pandemie nicht anders.
In diesem Befund liegt ein Problem für Praxis und Theorie gleichermaßen. Wo nämlich das staatliche Krisenmanagement bestehende Ungleichheiten verstärkt, weitet sich der Unmut der Bevölkerung schnell über eine situative Kritik an der Regierung hinweg auch ganz generell auf die von ihr in Anspruch genommenen Werte und Normen aus. Aus einer Krise in offenen Gesellschaften wird so schnell eine Krise der offenen Gesellschaft selbst, die von dem Eindruck zehrt, dass die „von den Eliten“ vielgepriesene Freiheit letztlich nur deren Besitzstandswahrungsinteresse, nicht aber „dem kleinen Mann“ dient.
Was müsste philosophisch geleistet werden, um diesem Problem beizukommen? Zunächst einmal sollte die Theorie der Praxis keine Knüppel zwischen die Beine werfen, indem sie einen unvermeidbaren Antagonismus zwischen entweder Freiheit oder Verantwortung suggeriert. Vielmehr ist zu zeigen: Es gibt einen dritten Weg, der beide Ziele vereint. Sodann sollte das, was wir Menschen einander schulden, in einem Diskurs herausgearbeitet werden, in dem staatlicher Zwang so legitimiert und bürgerliche Verantwortung so eingefordert wird, dass dabei die Freiheiten eines jeden mit der Freiheit und den Lebenschancen aller in Einklang gebracht werden. Denn wo die Freiheit aller den normativen Maßstab für öffentliche Entscheidungen bildet, dürften diese ihrerseits zumindest insofern auf erhöhte Akzeptanz treffen, als sie sich dann, wenigstens in gutem Glauben, nicht als illiberal ablehnen lassen.
Weshalb wir einer neuen Freiheitsphilosophie bedürfen…
Falls dies also die Aufgabe darstellt – eine Theorie anzubieten, welche die erforderlichen Bindungen der individuellen Freiheit im Interesse allgemeiner Freiheit plausibilisiert – , dann erweisen sich jedoch die lange vorherrschenden Freiheitstheorien „negativer“ versus „positiver“ Fassung als wenig hilfreich;[4] und das nicht nur, aber aber auch, weil sie alsbald in die Opposition libertärer und neoliberaler Freiheitskonzeptionen einerseits versus kommunitärer und konservativer sowie sozialdemokratischer Freiheitsvorstellungen andererseits übersetzt und damit ideologisch und parteipolitisch zugespitzt und vereinseitigt wurden: Dispute zwischen Anhängern negativer und positiver Freiheit endeten bisher ja bestenfalls in allzu brüchigen Kompromissen und schlimmstenfalls mit einem unaufhörlichen Tauziehen zwischen den Befürwortern der beiden Konstrukte.
Dieses unproduktive Ergebnis der bisherigen Debatten ist nicht zufällig, denn die Etiketten „negativ“ und „positiv“ passen, bei näherer Betrachtung, mehr schlecht als recht mit den von ihren Verkündigern verfochtenen Anliegen zusammen.
Negative Freiheit will nämlich stets etwas Positives – einen persönlichen Freiraum – schützen. Die Definition von Freiheit als “absence of physically coercive interference or invasion of an individual’s person and property“[5], welche als typisch für Vertreter negativer Freiheitstheorien gelten darf,[6] zeigt sofort an: Das negatorische Element tritt nur sekundär hervor, nämlich gegen Angriffe auf einen primär zu denkenden – und damit zunächst einmal positiv zu definierenden – Freiheitskreis. Wer sagt, “you are ‘free’ when you can constrain other people to refrain from constraining you“,[7]definiert negative Freiheit eben über ihr positives Schutzgut – obschon vielleicht unwissentlich.
Negative Freiheit fällt nicht vom Baum; sie hängt vielfach von positiven Freiheiten ab. Bereits für das Formen eines individuellen Lebensplans etwa, dessen Vollzug sodann unter den Schutz „negativer“ Freiheit fallen kann, sind Vorbedingungen erforderlich (etwa eine konsistente Willensbildung, Disziplin in der Ausführung usw.).[8] Deren Existenz hängt ihrerseits auch von „positiven“ Freiheiten (etwa Zugang zu Bildung) ab. Sie impliziert im weiteren Sinne zudem die Verfügung über bestimmte Grundgüter (Nahrung, Gesundheit, etc.); und auf letztere gewährt erst positive Freiheit einen krisenfest verlässlichen Zugriff.[9]
Mehr noch: Freiheit muss sich auf Gegenstände in der Welt beziehen können.[10] Um sie in diesen Sachbezügen (negativ) zu schützen, müssen dafür geeignete Institutionen, beispielsweise des Eigentumsschutzes, geschaffen werden. Diese rechtlichen Institutionen aber müssen ihrerseits so legitimiert werden, dass auch die durch solche Regelungen jeweils Benachteiligten ihre Geltung akzeptieren, etwa durch ein Verkoppeln mit Akten der Teilhabegerechtigkeit, welche nun aber traditionell durch Theorien positiver Freiheit legitimiert werden.[11] Kurz gesagt: Ohne positive Freiheit keine redistributive Gerechtigkeit; ohne diese kein nachhaltiger Schutz des individuellen Besitzes und Selbstentwurfs; mithin ohne positive keine negative Freiheit.
Viele Freiheitsphilosophen fragen daher heute gar nicht mehr, ob man dem Begriff negativer Freiheit einige Elemente positiver Freiheit beimischen solle, sondern nur noch welche. Man folgt dabei gerne Gerald MacCallum, der schon vor Jahrzehnten zeigte, dass Freiheit nie abstrakt, sondern immer nur sozial vermittelt vorliegt, und zwar in sowohl positiver wie negativer (sowie relationaler) Weise. In MacCallums Verständnis ist Freiheit stets die Freiheit “of something (an agent or agents), from something, to (do, not do, become or not become) something, it is a triadic relation.”[12] Daraus folgt: Eine sich nur auf negative Aspekte stützende Freiheitstheorie lässt sich nicht konsistent durchführen.
Nicht viel besser ist es um Theorien positiver Freiheit bestellt. Diese gehen nämlich über den Begriffsrahmen negativer Freiheit in so vielfältiger Weise hinaus, dass oft unklar bleibt, worauf es ihnen zentral ankommt. So bieten positive Freiheitslehren für gewöhnlich gleich mehrere der folgenden Ergänzungen zur negativen Freiheit an: die Bindung des Willens an Rationalität, seine Ausrichtung an moralischen Gesetzen und sittlichen Werten, die kollektive Orientierung an bestimmten kulturellen Kontexten und Traditionen, die Pflege partizipativ-republikanischer Regierungsmodelle, das Gewähren der pädagogischen Voraussetzungen autonomer Willensbildung sowie das kontrafaktische Herstellen der ökonomischen Bedingungen von Privatautonomie für alle und noch einiges mehr. Allerdings: Wer einige dieser Aspekte ablehnt, muss nicht alle verweigern; und umgekehrt, wer für manche dieser Dimensionen eintritt, hat nicht für jegliche zu streiten. Zugespitzt: Der Begriff negativer Freiheit ist klar, aber steril; die Idee positiver Freiheit ist fruchtbar, aber unklar. Unbefriedigend sind beide.
Einen theoretischen Neuanfang wagen?
Statt des untauglichen Schemas negativer versus positiver Freiheit benötigen eine verständliche Dialektik zwischen den unterschiedlichen Dimensionen der Freiheitsidee, welche die widerstreitenden Aspekte derselben ordnet, gewichtet und plausibel zu integrieren vermag. Dabei muss es vor allem gelingen, sowohl dem Interesse an einer Ausdehnung des individuellen Optionenraumes (typischerweise verfochten von Freunden der negativen Freiheit) als auch dem Wunsch nach einer verantwortlichen (etwa: sozial und ökologisch nachhaltigen) Gestaltung der persönlichen Lebenschancen sowie nach einer Ermächtigung aller zu einem Leben in würdiger Autonomie (typischerweise Anliegen von Parteigängern der positiven Freiheit) gerecht zu werden.
Für diese Aufgabe bietet sich als theoretische Linse die Unterscheidung zwischen einem quantitativen, auf die Masse unserer Handlungsoptionen konzentrierten und einem qualitativen, auf die Klasse unserer Lebenschancen abstellenden Freiheitsverständnis an.[13] Durch diese Unterscheidung (nicht zweier vermeintlich selbständiger Freiheitskonzepte, sondern innerhalb der einen Freiheitsidee zu bewahrender Aspekte) lassen sich, so meine These, globale Debatten über die Auswirkungen sowohl der Corona-Pandemie als auch anderer Krisen auf die persönliche Freiheit neu fassen.
Die Begründung für diesen Ansatz lautet, verknappt dargestellt, wie folgt: Im Zentrum des seit jeher umstrittenen Freiheitsbegriffs steht eine immer wieder neu aufzulösende Spannung, die nur durch die Integration zweier isoliert nicht zielführender Tendenzen behoben werden kann. Diese Spannung verläuft zwischen einerseits einer quantitativen Berücksichtigung von Freiheiten, die politische und wirtschaftliche Modelle daraufhin analysiert, inwiefern sie individuelle Wahlmöglichkeiten maximieren und gesellschaftliche Zwänge minimieren, und andererseits einer qualitativen Verpflichtung, bestimmte Arten von Freiheiten (z.B. nachhaltige, verantwortliche Formen) gegenüber anderen zu bevorzugen.
Im Lichte dieser terminologischen Neuformatierung zeigt sich schnell, dass die quantitative Perspektive (in Bezug auf die Optionen, die Einzelnen stets, auch in Krisenzeiten, verbleiben müssen) nicht als alleinentscheidend angesehen werden kann, sondern mit qualitativen Überlegungen (hinsichtlich der Art und Güte jener Optionen) vermittelt werden muss. Denn reine Quantität kann nicht gedacht werden; sie ist stets die Quantität von etwas, das seinerseits qualitativ bestimmt ist. Insofern kommt begriffslogisch das qualitative Moment zuerst. Jedoch kann Qualität ihrerseits nicht vollständig begriffen werden, ohne zu zeigen, wo ein bestimmtes Etwas endet, indem es sich von anderem abgrenzt: die Quantität gehört also zum Wesen des Qualitativen. Im Ergebnis: Qualitatives Abwägen kommt vor quantitativem Abwiegen – aber ohne es nicht aus.
Werden diese kategorialen Bestimmungen auf den Freiheitsbegriff übertragen, so erlaubt dies eine nuancierte(re) Formulierung des Verhältnisses zwischen individueller Freiheit und sozialer Verantwortung. Insofern beide Aspekte unter der Ägide des Qualitativen zur Geltung gebracht werden, lässt sich der andernfalls abstrakte Gegensatz zwischen entweder einem Minus an Freiheit oder einem Minus an Verantwortung auflösen. Wir sollten also das Verhältnis von öffentlicher Gesundheit und Freiheit (wie zu Zeiten der Corona-Pandemie), von kollektiver Sicherheit und Freiheit (wie im Fall des Terrorismus) und von nationaler Kultur und kosmopolitischer Freiheit (etwa im Hinblick auf Migration) und schließlich von ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Freiheit (in Debatten über die Erderwärmung) nicht rein quantitativ denken und so tun, als seien alle diese Ziele und Werte nur um ein Minus an Freiheit zu haben oder diese umgekehrt nur durch eine Zurücknahme jener. Vielmehr muss unsere Frage lauten, wie die Idee Freiheit intern qualifiziert werden kann, so dass bestimmte Formen von Freiheit priorisiert bzw. allererst geschaffen werden, die im Einklang mit den genannten Zielen stehen.
Um beim Versuch dieser internen Fortbestimmung der Freiheit allerdings nicht deren autonomen Kern durch heteronome Festlegungen zu verspielen, müssen diese Konkretisierungen aus und durch Freiheit selbst erfolgen. Das ist auch, doch nicht allein prozedural gemeint: Partizipatorische Verfahren sollten der Freiheitsidee konkrete Konturen verleihen. Aber das reicht nicht. Sie brauchen ihrerseits, allein schon für ihre verfassungsrechtliche Koordination und praktische Kohärenz, einen normativen Fluchtpunkt. Und jener kann, soll der freiheitliche Grundgedanke nicht sofort wieder verspielt werden, nur aus dem Anspruchsrecht der Einzelnen auf Freiheit resultieren. Anders formuliert: Freiheit soll Grund, Grenze und Maß ihrer eigenen Beschränkung sein. Wie kann dies gelingen?
Freiheit kommt, nach klassisch-liberaler Lesart, Individuen nicht aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Klasse, einem Geschlecht, einer Religion oder Ethnie usw. zu, sondern schlechthin als Personen. Wenn aber der Anspruch auf Freiheit genau so begründet wird, so muss dies eben für alle Personen gelten; für solche, die uns räumlich, zeitlich oder zivilisatorisch fern sind ebenso wie für jene, mit denen wir uns bereits in Nahverhältnissen befinden. Knapper ausgedrückt: Menschen können Freiheit individuell genau dann legitim für sich beanspruchen, insofern sie dieselbe universell gelten lassen. Aus dieser immanenten Qualifikation der persönlichen durch universale Freiheit folgt (zeitlich) ihre intergenerationale, sowie (räumlich) ihre kosmopolitische Verantwortung. Diese – qualitative – Verpflichtung muss durchgesetzt werden, bevor man sich – quantitativ – ans Ausweiten der in Rede stehenden Optionen macht.
Der Ertrag der bisherigen Überlegungen: Das Schaffen, Stärken und Schützen von Lebenschancen für alle erscheint, von dieser Warte aus betrachtet, nun keineswegs als übles Hindernis, sondern als zielführende Teilstrecke auf dem Weg zu einer konsequenten Realisierung der Freiheitsidee. Auf die Formel gebracht: Freiheit verpflichtet; Verantwortung befreit. Die qualitative Fassung des Freiheitsbegriffs verlangt, individuelle Freiheiten so zu gestalten, dass die Freiheiten aller Beteiligten dabei – verfahrenstechnisch wie inhaltlich – respektiert werden. Diejenigen, die passiv von Entscheidungen betroffen sind, haben das Recht und sollten die Mittel erhalten, sich aktiv mit diesen Entscheidungen zu befassen; allein schon, um erforderliche Regulierungen nicht als externe Schranken zurückweisen, sondern als interne Bestimmungen anerkennen zu können.
So auch ließe sich in pluralistischen Gesellschaften die Einheit der Freiheitsidee angesichts der Vielfalt seiner von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit variierenden Anwendungsformen bewahren. Das ist nicht nur normativ sinnvoll –dem Prinzip der Subsidiarität folgend –, sondern auch lösungseffizient. Es ermächtigt und ermuntert dazu, gesellschaftliche Probleme auch mit dezentralen, experimentellen Strategien anzupacken, bei denen der Staat nicht als alleiniger Problemlöser auftritt, sondern sich zunehmend auf Zivilgesellschaft und Wirtschaft stützt.[14] Schließlich wird immer deutlicher, dass und wie lokal eingebettetes und kontextgebundenes Wissen die gesellschaftliche Entscheidungsfindung verbessern kann.[15] Solche ko-kreativen Ansätze zur Regierungsführung sind jedoch in den traditionellen, vor allem: in „negativen“ Freiheitstheorien äußerst selten zu finden.[16] Und das muss sich ändern, soll Freiheit nicht nur ein Ideal für Bürger offener Gesellschaften, sondern auch von ihnen sein – und bleiben.
An welchen Problemen gilt es sich zu bewähren?
Die Leistungskraft der hier in Anschlag gebrachten Theorie qualitativer-inklusive-quantitativer Freiheit lässt sich im Rahmen dieses kurzen Textes nicht in allen Einzelheiten nachweisen, wohl aber im Hinblick auf die Corona-Pandemie aufweisen. Mit der Theorie qualitativer Freiheit kommen vor allem folgende Punkte auf die Agenda einer konstruktiven öffentlichen Diskussion über Corona-Politik.
- Digitalisierung: Wie effektiver Gesundheitsschutz und digitale Selbstbestimmung einander verstärken, statt sich auszuschließen, zeigt die deutsche Corona-App. Statt unsicherer Schnellschüsse, die Nutzer abschrecken, hat die Diskussion eine sichere und darum auch weithin akzeptierte Variante hervorgebracht. Ähnliche Diskussionen über die Vereinbarkeit von digitaler Arbeit und Bildung mit Sozialität und Offline-Begegnungen stehen uns bevor. Wir sollten dabei stets fragen: Welche Freiheiten werden so jeweils erweitert oder verringert? Was sind die sozialen und ökologischen Auswirkungen der krisenbedingt verstärkten Digitalisierung und wessen Freiheiten werden dadurch gefördert oder behindert?
- Nützlichkeit versus Autonomie: Die durch die Pandemie ausgelöste Triage-Debatte hat die Diskussion darüber verschärft, wer warum das Recht hat, menschliches Leben zu beenden. Es ist klar, dass die Freiheit einiger zu überleben und die Freiheit anderer, gut zu leben, bei verknappter medizinischer Versorgung durchaus miteinander in Konflikt geraten können. Der dringende Bedarf an klaren Richtlinien, gepaart mit dem starken öffentlichen Interesse an der Klärung dieser Fragen, zwingt uns etwa zu entscheiden, wann gesellschaftlicher Nutzen hinter der Würde und Autonomie der Einzelnen zurückstehen muss. Diese Frage kann nicht ohne Rückgriff auf ein Freiheitskonzept gelöst werden, das qualitativ die Rechte und Verantwortlichkeiten aller Beteiligten berücksichtigt und nicht nur, rein quantitativ, die Interessen bestimmter Kreise maximiert.
- Kausalität und Kontrafaktisches: Die Gegner des wirtschaftlichen „Shutdown“ behaupteten, die ergriffenen Maßnahmen richteten durch die nachfolgende Rezession mehr Schaden als Nutzen an. Stimmt das? Wie kann man überhaupt Nutzen und Schaden des eingeschlagenen Wegs mit jenem nicht eingeschlagener Pfade abwägen? Bei solchen Überlegungen sind stets Entscheidungen unter Unsicherheit über Kausalitätspfade zu fällen, deren Verlauf zumeist durch Gedankenexperimente voll kontrafaktischer Hypothesen und darauf gestützte Statistiken abgeschätzt wird. Wer hat das Recht bzw. in wessen Freiheit liegt es, solche Bewertungen letztgültig zu treffen? Das darf in einer offenen Gesellschaft nicht technokratisch durchgezogen, sondern muss demokratisch ausgetragen werden – und das normative Prinzip dafür ist die Autonomie aller.
- De-Wachstum, De-Globalisierung, Verlangsamung: Einige Kommentatoren der Krise fordern mehr Global Governance ein und interpretieren die Corona-Pandemie als weiteren Indikator für die wachsende Notwendigkeit einer verstärkten Koordination und Kollaboration auf weltweiter Ebene. Andere tendieren in die Gegenrichtung und stellen als positive Rückwirkung der Corona-Krise fest, dass sie uns die Augen für alternative Lebensformen öffnete. Schließlich hätten abgedroschene Argumente – etwa über eine „alternativlose“ Politik angesichts von „Wirtschaftsgesetzen“, die uns zu einer immer rasanteren Globalisierung zwängen – jüngst viel an Überzeugung eingebüßt, da auf einmal die Politik erneut ihren Primat vor der Wirtschaft betonte und ihre Fähigkeit demonstrierte, unsere Lebensweise abrupt und drastisch zu verändern. Dadurch hat die Debatte darüber Fahrt aufgenommen, ob wir unsere gesellschaftlichen Prozesse verlangsamen sollten (etwa um der Freiheit zu einem kontemplativeren oder geselligeren Lebensstil willen), auf weniger Wachstum umstellen (um der Umwelt eine Atempause zu verschaffen und autochthone Produktionsformen zu unterstützen) oder auch de-globalisieren sollten (um lokale Kulturen sowie wirtschaftliche Autarkie zu bekräftigen, insbesondere in Bezug auf medizinische Versorgung oder strategische Güter). Die Bewertung dieser Alternativen muss berücksichtigen, ob und wie sie sich jeweils auf die Freiheiten aller auswirken; und zwar nicht nur derer, die privilegiert genug sind, um (ohne größere Kosten oder Opfer ihrerseits) die Vorteile solcher Veränderungen zu genießen.
Alle genannten Problemfelder erfordern eine tiefere Analyse der Freiheiten, die sowohl von den Verteidigern des status quo als auch der avisierten Änderungen desselben angeführt werden. Für die Entscheidungsfindung sollte die Legitimation der einschlägigen (quantitativen) Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten aus dem Freiheitsbegriff selbst folgen, indem die (qualitativen) Konturen der individuellen Freiheit im Lichte der Idee universeller Freiheit gezogen werden. Es geht schließlich nicht nur um die Zusicherung bestehender Freiheiten für einige Wenige, sondern um die Freiheit und Autonomie aller Menschen, einschließlich der künftigen Generationen.[17]
Der entscheidende strategische und kommunikative Vorteil dieser Neuausrichtung des Freiheitsverständnisses liegt in der Abwehr der Ansicht, dass moralische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit, bürgerliche Verantwortung, Sicherheit und Gesundheit allesamt nur um den Preis der Freiheit erworben werden können. Denn, wo diese Meinung vorherrscht, sind die Aussichten für offene Gesellschaften in der Tat düster. In jenem verfehlten, von Libertären wie Autoritären gepflegten Denkrahmen scheint die bürgerliche Freiheit unweigerlich mit allem, was Menschen sonst noch lieb und teuer ist, in Konflikt zu stehen.
Dem lässt sich allerdings nicht durch eine Gegenoffensive begegnen, welche die Freiheitsidee nun ad hoc mit allen möglichen wünschenswerten Gehalten auflädt; was im Übrigen von Libertären als illegitim zurückgewiesen würde – und von Autoritären als redundant, weil man derlei, so deren Argument, durch Diktat viel flotter erreichen kann. – Nein, wir müssen zeigen, dass Freiheit von Grund auf missverstanden ist, solange wir nicht die von ihrer Regulierung Betroffenen zu Beteiligten ihrer Gestaltung machen – und zwar indem die Rechte aller Weltbürger auf Freiheit zu ihrer lokalen, nationalen wie regionalen Ausdifferenzierung herangezogen werden. Wo nämlich der Freiheitsgebrauch vor Ort im Lichte seiner globalen Auswirkungen kosmopolitisch ausgerichtet und verantwortet wird, können die daraus resultierenden Bindungen und Einschränkungen individueller Freizügigkeit weder als illegitim beleumundet noch – gerade auch im Hinblick auf die globale Dimension der Pandemiebekämpfung – als probleminadäquat belächelt werden.
Libertäre wie Autoritäre werden also gleichermaßen in die Schranken gewiesen von einer auf ihre globale Verantwortung ausgerichteten Freiheitstheorie, welche die Freiheit vor Ort zuerst qualitativ im Blick auf die Anrechte aller Weltbürger konturiert, bevor sie uns ermächtigt und ermuntert, deren lokalen Radius, je nach Kontext unterschiedlich, quantitativ zu optimieren.
Ist das denn auch „gut katholisch“?
Ich habe die Konzeption einer primär qualitativ orientierten Freiheit bisher mit rein säkularen Argumenten aufgebaut; und das ist auch angesichts der Rolle, die eine solche Theorie in einer offenen Gesellschaft spielen soll, angezeigt, um ihr über alle weltanschaulichen Grenzen hinweg Chancen auf Anerkennung zu verschaffen. Zugleich aber soll an dieser Stelle nicht der Hinweis ausgelassen werden, dass diese Position auch mit weiten Teilen der katholischen Soziallehre übereinstimmt.
Schon im Mittelalter unterschied christliche Philosophie routinemäßig zwischen einer gegen ihre inhaltliche Ausrichtung gleichgültigen libertas indifferentiae und einer auf deren sittliche Vorzüglichkeit abstellenden libertas excellentiae.[18] Damit war ein Spannungsfeld aufgemacht, das bis auf den heutigen Tag das sozialethische Denken der Kirche beschäftigt. Es gilt, einen Weg zu finden, der Reduzierung des Wesens der Freiheit auf bloße Willkür klar zu widersprechen; einerseits. Andererseits aber stellt sich die Frage, ob wirklich der Wert der Freiheit mit der Summe aller sittlich hochwertigen Freiheitsvollzüge gleichgesetzt werden darf.
Diesbezüglich hatten sich bis ins späte 19. Jahrhundert hinein einige Enzykliken dahingehend festgelegt, dass nur eine mit dem kirchlichen Lehramt konform gehende Freiheit wertzuschätzen sei. Erst im 20. Jahrhundert wurden hier die Markierungen anders gezogen. Neben das moraltheologische Preisen eines sittlich hochstehenden und religiös ausgerichteten Freiheitsgebrauchs trat nun eine rechtstheologische Würdigung der individuellen Autonomie an sich; also eine, die es toleriert, wenn in bestimmten Bereichen der persönliche Gebrauch der staatlich eingeräumten Freiheitsräume moralisch und religiös viel zu wünschen übrig lässt. Diese Toleranz wird dabei heutzutage nicht mehr als lasch-pragmatisches Abstehen und Absehen von einer eigentlich gebotenen Rigidität angesehen, sondern vielmehr als unverzichtbare Grundlage dafür gewürdigt, dass Menschen sich aus freien Stücken zu einem Leben in Sittlichkeit und aus dem Glauben heraus bestimmen können sollen. Die Möglichkeit der moralisch wie religiös verfehlten Wahlentscheidungen wird also gebilligt aufgrund der höheren Wertigkeit, die einer sich aus Freiheit zur Verantwortung ausrichtenden Lebensführung zukommt.
Mehr noch: Die qualitative Verpflichtung der individuellen Freiheit, dazu beizutragen, alle Weltbürger zu einem autonomen Leben zu befähigen und ihnen dafür die formalen wie materiellen Voraussetzungen einzuräumen, stehen in starker Übereinstimmung mit christlichen Lehrsätzen, die auch die Fernsten zu unseren Nächsten erklären, weil sie in allen Menschen Kinder Gottes erkennen, die auf geschwisterliche Fürsorge Anspruch erheben können. Gedanken, die insbesondere seit Mitte des 20. Jahrhunderts in der lateinamerikanischen Theologie[19] eindeutige Akzente gesetzt haben: zugunsten einer qualitativen Orientierung der Freiheit an der Befreiung und Emanzipation anderer, zugunsten einer Beteiligung der Betroffenen am Regierungshandeln und, nicht zuletzt, zugunsten einer „präferentiellen Option“ für die Armen, deren Bedürftigkeit ihnen ansonsten den Weg zu einer würdevollen Selbstbestimmung verstellt. Mit all diesen Punkten deckt sich der hier vorgetragene Ansatz vollauf.
Kurz zusammengefasst: Perspektiven für künftiges Krisenmanagement
Ich habe argumentiert, dass die Corona-Krise nicht angemessen verstanden und bewältigt werden kann, ohne sich mit der schon länger schwelenden Krise des Freiheitsideals in offenen Gesellschaften auseinanderzusetzen. Die über den gegenwärtigen Moment hinausweisende Bedeutung der Pandemie – und was von ihr etwa für die Bewältigung künftiger Krisen gelernt werden kann – lässt sich nicht erfassen, ohne sich mit der begrifflichen Wurzel des Freiheitsideals auseinanderzusetzen.
Dabei erweist sich allerdings die hergebrachte Schablone einer Unterscheidung von „negativer“ versus „positiver“ Freiheit als wenig hilfreich, weil sie sprachlich unsauber und sachlich irreführend ist, indem sie den verfehlten Eindruck erweckt, negative Freiheit könne ohne positive Freiheit bestehen. Die in der bisherigen Freiheitsdiskussion vorrangigen Bestrebungen (das numerische Maximieren und das inhaltliche Optimieren) lassen sich weit besser mit den Kategorien der Quantität und Qualität einfangen. Dabei zeigt sich allerdings, dass eine nur auf die Masse und nicht auch auf die Klasse unserer Optionen abstellende Theorie unausführbar ist. Stattdessen haben wir mit einer Abwägung der Qualität freiheitlicher Lebenschancen zu beginnen, die wir miteinander füreinander sichern wollen, um danach dann – demokratisch, nicht technokratisch – auszumachen, wie wir den Raum dieser erstrebten Chancen quantitativ abgrenzen, ausbauen und nachhaltig gestalten.
Auf diesem Weg lässt sich zeigen, dass bestimmte Einschränkungen individueller Freizügigkeit und etliche soziale Bindungen persönlicher Autonomie genau dann keine Negation von Freiheit darstellen, wenn sie im Lichte des Anrechts aller Weltbürger auf ein Leben in Freiheit erfolgen. Die Fragen, welche die Corona-Krise im Hinblick auf unsere Haltung zu Globalisierung, Technologie, dem Recht auf würdevolles Leben und Sterben und nicht zuletzt hinsichtlich des Rechts auf demokratische Partizipation an gesellschaftlichen Beschlüssen aufwirft, kreisen ja allesamt um die doppelte Herausforderung, einerseits an der Freiheit der Einzelnen festzuhalten ohne andererseits anderen die Chance auf ein autonomes Leben zu verwehren. Wo dabei die Politik die Freiheitsräume der Bürger in kosmopolitischer Verantwortung konkretisiert, kann die schwierige Balance gelingen, den Pluralismus offener Gesellschaften zu bewahren und zugleich genügend inneren Zusammenhalt wie externe Zusammenarbeit zu ermöglichen, um der gegenwärtigen Pandemie wie auch künftigen Krisen in verantwortlicher Freiheit zu begegnen.
[1] Vgl. Karl Raimund Popper, The Open Society and its Enemies, Princeton/New Jersey 2013 (Erstausgabe: 1945).
[2] Vgl. Ivan Krăstev, Stephen Holmes, The Light That Failed: Why the West Is Losing the Fight for Democracy, New York 2019.
[3] Vgl. Pankaj Mishra, Age of Anger, London/New York 2017.
[4] Zum Diskussionsstand s. Ian Carter, Matthew H. Kramer, Hillel Steiner, Freedom: A Philosophical Anthology, Malden, Massachusetts 2007, S. 4-5.
[5] Murray Newton Rothbard, The Ethics of Liberty, Atlantic Highlands/New Jersey 1982, S. 215.
[6] Vgl. Jan Narveson, The Libertarian Idea, Philadelphia 1988; John Hospers, Paul Avrich Collection (Library of Congress), Libertarianism: A Political Philosophy for Tomorrow, Los Angeles 1971.
[7] Bruno Leoni, Freedom and the Law, Princeton, New Jersey 1961, S. 56.
[8] Vgl. Joseph Raz, The Morality of Freedom, Oxford 1986, S. 408.
[9] Vgl. Stanley Isaac Benn, A Theory of Freedom, Cambridge/New York 1988; Raz, Morality, a.a.O., S. 407.
[10] Vgl. Philippe van Parijs, Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism?, Oxford/New York 1995, S. 22.
[11] Vgl. Gerald Allan Cohen, Self-Ownership, Freedom, and Equality, Cambridge/Paris/New York 1995.
[12] Gerald C. MacCallum, Jr., Negative and Positive Freedom, in: The Philosophical Review, 76, No. 3 (1967): S. 312-334, S. 314 (Herv. i. Orig.).
[13] Ausführlich: Claus Dierksmeier: Qualitative Freiheit – Selbstbestimmung in weltbürgerlicher Verantwortung, Bielefeld 2016.
[14] Vgl. Neera Chandhoke, Putting Civil Society in Its Place, in: Economic and Political Weekly, 44 / 2009: S. 12-16.
[15] Vgl. Amartya Sen, Rationality and Freedom, Boston MA 2002.
[16] Vgl. Comor, E., The Role of Communication in Global Civil Society: Forces, Processes, Prospects, in: International Studies Quarterly, 45 / 2001: S. 389-408.
[17] Ähnliche Argumente bei: Thomas Pogge, Freedom From Poverty as a Human Right: Who Owes What to the Very Poor?, New York (UNESCO) 2007; Philip Pettit, Just Freedom. A Moral Compass for a Complex World, New York 2014.
[18] Dazu näher: Leo XIII., Human Liberty, Encyclical Letter, New York 1941 und Servais Pinckaers, The Sources of Christian Ethics, Washington, D.C. 1995.
[19] Dies gilt besonders für die befreiungstheologischen Schriften von Gustavo Gutierrez (Gustavo Gutierrez, A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation, Maryknoll/New York 1973) und Ignacio Ellacuría (Ignacio Lee Michael Edward Ellacuría, Ignacio Ellacuría: Essays on History, Liberation and Salvation, 2013).
Der Verfasser
Claus Dierksmeier ist Professor für Globalisierungsethik an der Universität Tübingen. Seine Arbeit konzentriert sich auf Fragen der Politik-, Religions- und Wirtschaftsphilosophie unter besonderer Berücksichtigung von Theorien der Freiheit und der Verantwortung im Zeitalter der Globalität.